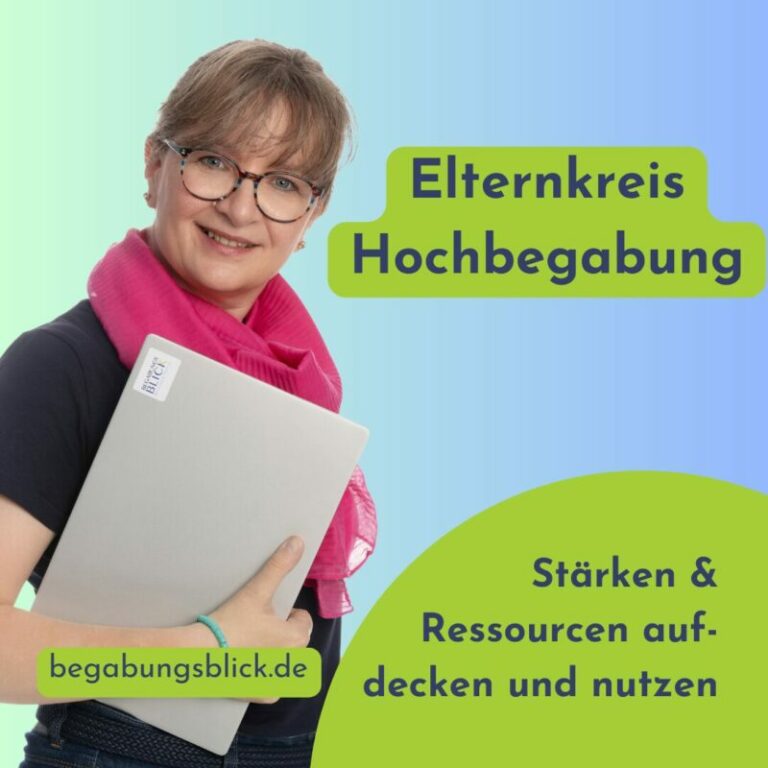Hochbegabung und Hochsensibilität
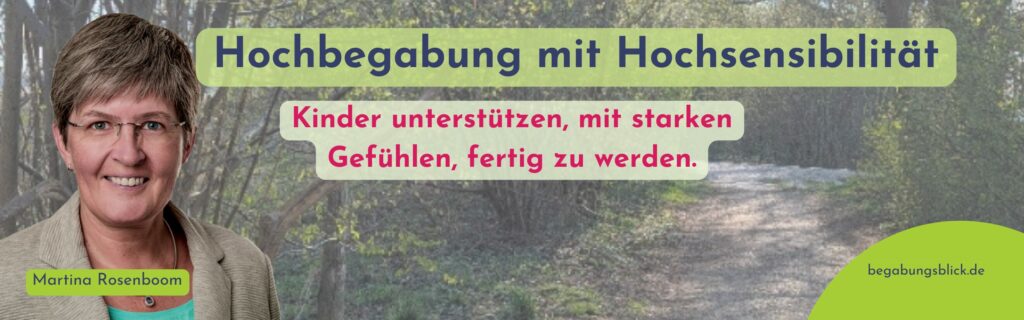
Hochbegabung und Hochsensibilität
Hochbegabung und Hochsensibilität werden häufig als Problem gesehen. Möchtest du geniale Fähigkeiten klug begleiten? Dann lies weiter!
Hochbegabung und Hochsensibilität werden immer häufiger als Neurodivergenz bezeichnet. In diesem Zusammenhang werden insbesondere die Probleme in den Vordergrund gestellt. Tatsächlich ist es aus meiner persönlichen Erfahrung nicht richtig, sich zwangsläufig als Opfer einzusortieren. Leider suggerieren viele Artikel und Beiträge in Social Media diese destruktive Haltung.
Gerne möchte ich dir eine andere Perspektive anbieten und gleichzeitig einige Lösungsansätze für einen passenden Umgang.
Martina Rosenboom hat mir zu dem Thema zwei wundervolle Texte zur Verfügung gestellt.
Hochbegabung und Hochsensibilität – Wie hängt das zusammen?
I CAN – ich kann das! Kinder unterstützen, mit starken Gefühlen fertig zu werden
Martina und mich eint, dass wir beide unermüdlich nach Lösungen für Eltern hochbegabter Kinder suchen.
Kennengelernt habe ich Martina Rosenboom in der DGhK Niedersachsen/Bremen. Als ich als Neuling beim ersten Aktiventreffen eintraf, war sie bereits unsere Vorsitzende und hatte bereits viel erreicht. Mit ihrer guten Struktur hat sie uns Beraterinnen der Elterngruppen unterstützt.
Heute unterstützt sie mich im Begabungsblick mit richtig guten Texten, die auf der Seite vielfach gelesen und empfohlen werden. Es ist übrigens Martinas Verdienst, dass regelmäßig Elternkreise Hochbegabung von Begabungsblick angeboten werden.
Unsere Erfahrung über sehr viele Jahre ist:
Eltern benötigen Austausch mit anderen Eltern hochbegabter Kinder
Eltern benötigen erfahrende Expertinnen, die Eltern ihre eigenen Lösungen finden lassen
Das klingt einfach? Letztlich war es ein langer Prozess, bis ich mich zu dieser Ausbildung habe überreden lassen. James T. Webb ist eben ein anerkannter Psychologe mit dem Schwerpunkt „Hochbegabung“, und das hat mich überzeugt.
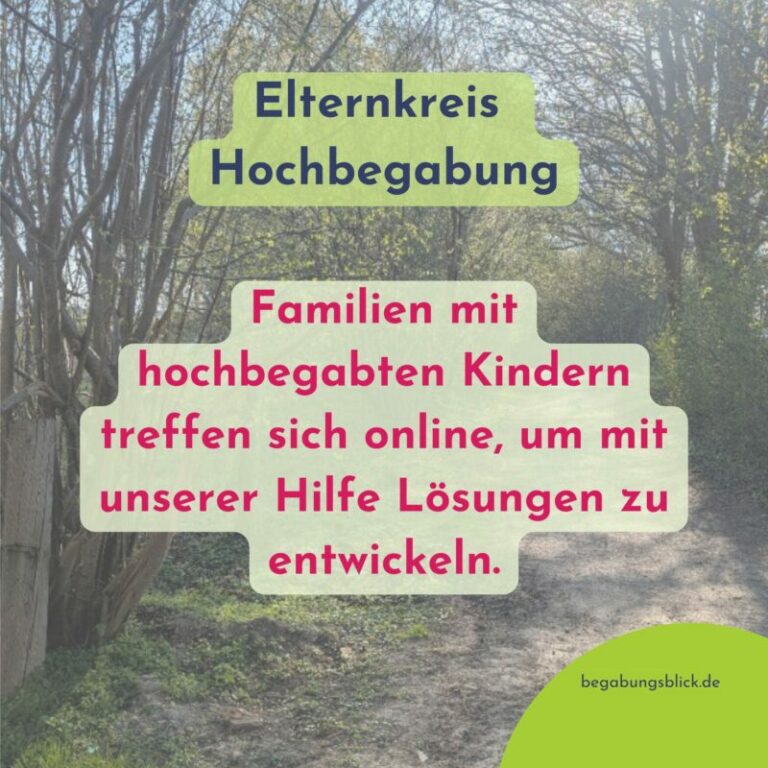
Hochbegabung und Hochsensibilität – Wie hängt das zusammen?
Hochbegabung kann sich in vielen Bereichen zeigen, denn hochbegabte Kinder zeichnen sich durch schnelleres Lernen, genaueres Beobachten und tieferes Nachdenken aus. Wenn Kinder aber genauer hinsehen, wenn sie mehr wahrnehmen und mehr Dinge sie zum Nachdenken anregen, dann spricht man auch von Hochsensibilität oder englisch „Overexcitability“. Manche Forscher wie z. B. Kasimierz Dabrowski sagen: Damit ein Kind mehr wahrnehmen kann, müssen seine „Kanäle“ offener sein. Dieses hohe Empfindungsvermögen wird von einem hochsensiblen Kind oft als störend wahrgenommen. Dann ist es ihm in der Kita zu laut, der Film ist zu traurig, der Pullover ist zu kratzig. Dabei gehören aber auch übergroße Freude, eine sehr lebhafte Fantasie und sehr tiefe Bindungen dazu – und das kann sehr bereichernd sein.
Wichtig ist bei all dem: Ein sehr hohes Empfindungsvermögen ist, keine Krankheit. Es geht darum, diese Eigenschaft anzunehmen, mit den negativen Seiten auszukommen und die positiven Seiten hochsensibler Kinder anzuerkennen.
Schau dir diese fünf Formen der Hochsensibilität an und wie du als Mutter oder Vater damit umgehen kannst
Psychomotorisches Empfindungsvermögen bei hochsensiblen Kindern
Eine hohe (psycho)motorische Sensibilität äußert sich z. B. früh in schnellem Sprechen, in einer Vorliebe für schnelle Sportarten oder das ständige „Noch einmal rutschen!“ oder „Schneller, schneller!“ auf dem Spielplatz. Weitere Anzeichen sind eine deutliche Begeisterungsfähigkeit, Schauspielern, zwanghaftes Reden und Plaudern, impulsive Handlungen, manchmal auch nervöse Angewohnheiten wie Nägelkauen oder Tics.
Bei manchen Kindern zeigt es sich auch in zwanghaftem Organisieren und Konkurrieren: „Ich mache schon mal einen Plan“ und „Wer schneller am Baum ist!“.
Aktion, Bewegung, Machen – oft reicht es, wenn du als Mutter oder Vater den Raum schaffst, dass dein Kind sich hier ausleben kann.
So kann sich auch ein sportliches Talent gut entwickeln. Diesen hohen Bedarf an Bewegung und Aktivität sollte man nicht verwechseln mit Hyperaktivität, da die hochsensiblen Kinder bei ihren Interessen zu fokussierter Aufmerksamkeit und Konzentration fähig sind.
Hochsensible Kinder mit sensorischem Empfindungsvermögen
Gerüche oder Geräusche können von hochsensiblen Kindern wesentlich intensiver wahrgenommen werden. Teilweise kommt es zu Reaktionen auf bestimmte Textilien, Pullover sind „kratzig“, auch eingenähte Schilder können als sehr störend empfunden werden. Die sensorische Sensibilität kann sich z. B. in einer Unverträglichkeit bestimmter Nahrungsmittel ausdrücken. Dann ist z. B. Milchreis oder ein Gemüse „eklig“, und es geht dem Kind wirklich schlecht beim Essen. Viele Kinder ertragen keine hohe Lautstärke, vor allem in der Kita oder der Schule.
In manchen Schulen dürfen sich hochsensible Kinder bei der Stillarbeit oder bei Klassenarbeiten deshalb Kopfhörer aufsetzen.
Kinder mit einer sensorischen (Über)Empfindlichkeit sind auf der anderen Seite oft sehr genussfähig und zeigen häufig eine ausgeprägte Wertschätzung für schöne Objekte, Farben und Wörter.
In der Kita ist es deiner Tochter immer zu laut, zu Hause hört sie aber gern Musik. Dein Kind möchte vielleicht Holz im Wald immer anfassen und daran riechen, möchte es mit allen Sinnen aufnehmen.
Dann gibt es eine kuschelige Lieblingsdecke oder dein Kind schmilzt beim Lieblings-Schoko-Eis fast dahin. Solche Genuss-Momente lassen sich oft schon mit Kleinigkeiten erreichen und vielleicht kannst du dich auf dieses intensive Erleben zusammen mit deinem Kind einlassen.
Kinder mit Hochsensibilität können ein intellektuelles Empfindungsvermögen haben
Eine intellektuelle Sensibilität äußert sich oft schon im Kita-Alter. Dein Kind stellt früh untersuchende und testende Fragen oder kann sich in langen Phasen von Konzentration und Ausdauer mit neuen Inhalten beschäftigen. Hier ist eine große Ähnlichkeit zur klassischen Hochbegabung zu sehen.
Intellektuelle Sensibilität zeigt sich oft in leidenschaftlichem Lesen, in detailliertem Planen und vorausschauendem, gedanklichem Verarbeiten von Handlungen oder Ereignissen. Häufig beobachtet man die Fähigkeit zu ausgedehnten intellektuellen Anstrengungen, wie beispielsweise dem „Denken über das Denken“.
Diese Eigenschaften sind nicht mit denen schnelldenkender Normalbegabter zu verwechseln, denn das Denken geht bei hochbegabten oder intellektuell hochsensiblen Kindern nicht nur schneller, sondern auch tiefer.
Eine hohe intellektuelle Sensibilität schließt moralische und intuitive Aspekte ein und geht somit auch über das Konstrukt von „kognitiver Intelligenz“ hinaus. Hier lohnt sich auch ein Blick auf die verschiedenen Formen von Intelligenz von Howard Gardner.
Imaginäres Empfindungsvermögen bei Hochsensibilität
Diese hohe Sensibilität ist eng verbunden mit Kreativität. Kinder mit hoher imaginärer Sensibilität erfinden oft Begleitpersonen oder -objekte als Gesellschaft für sich. Sie träumen komplex und sind anfällig für Albträume. Es ist nicht gut, die Fantasie-Monster abzutun. Besser ist es, gemeinsam Fantasie-Verteidigungen zu finden.
Manchmal haben hochsensible Kinder schnell Angst vor Unbekanntem, da für sie vieles vorstellbar ist, aber emotional bisher nicht verarbeitet werden kann.
Da werden z. B. Krankheiten oder der Tod sehr bildlich als Monster dargestellt. Du kannst dein Kind dazu anregen, seine Vorstellungen zu malen oder zu beschreiben. So könnt ihr euch darüber austauschen und dein Kind ist mit seinen Vorstellungen nicht allein.
Die Fantasie dieser hochsensiblen Kinder mit hohem Vorstellungsvermögen ist sehr lebendig, was unter anderem an der Fähigkeit zur detaillierten Visualisierung und an dem poetischen und dramatischen Ausdrucksvermögen zu beobachten ist.
Viele zeigen einen ausgeprägten Sinn für Humor und denken sich vollkommen unsinnige Geschichten, Figuren oder Situationen aus. Auch animistisches und magisches Denken, wie z. B. das Beleben von Objekten oder die Vermischung von Realität, Fiktion und Illusion, sind häufige Anzeichen hoher imaginärer Sensibilität.
Wenn du dich darauf einlassen kannst, dann könnt ihr damit viel Spaß haben! Wenn Kinder diese Geschichten aufschreiben, dann kann das eine Art Geschichten-Tagebuch werden. Manche mögen ihre Vorstellungen auch teilen und ihr könnt später noch darauf zugreifen. Viele berühmte Autoren und Autorinnen haben so angefangen!
Emotionales Empfindungsvermögen bei hochsensiblen Kindern
Die hohe emotionale Sensibilität ist wahrscheinlich die wichtigste der fünf genannten Aspekte bei Hochsensibilität. Sie drückt sich in der Fähigkeit zu emotionaler Intensität, Sensibilität und Empathie aus. Diese Zuneigung und emotionale Bindung zu anderen zeigt sich oft auch gegenüber Tieren.
Häufig erleben sich Kinder mit emotionaler Sensibilität, als wäre etwas mit ihnen nicht in Ordnung, da sie von Inhalten betroffen sind, an denen andere sich nicht stören: „Wie kann man diesen Film ansehen, ohne weinen zu müssen?“. Es hilft ihnen nicht, sie nur als zu sensibel zu bezeichnen, sondern sie benötigen Hilfe, um ihre Emotionen zu schätzen und zu nutzen zu lernen. Extrem positive und negative Gefühle sind z. B. Angst, Wut, Sorgen und Schuldgefühle, aber auch Begeisterung, Glück und Euphorie.
Kinder mit emotionaler Sensibilität identifizieren sich oft mit den Gefühlen anderer. Sie können sich mit anderen mit freuen oder mit ihnen mitleiden. Dies äußert sich oft in tiefen Freundschaften, weil sie sich ganz auf die Gefühle von Freunden einlassen, z. B. ein Freund, der sich wirklich über meinen Erfolg mit-freut, oder eine Freundin, die meinen Schmerz wirklich mit-erlebt. Dies hängt eng zusammen mit der interpersonellen Intelligenz (nach Gardner).
Auch zu ihren eigenen Gefühlen haben Kinder mit hohem emotionalem Einfühlungsvermögen einen guten Zugang: sie können ihre Gefühle oft verständlich beschreiben, erinnern und reflektieren. Dieser gute Blick „nach innen“ wird auch als „intrapersonelle Intelligenz“ bezeichnet.
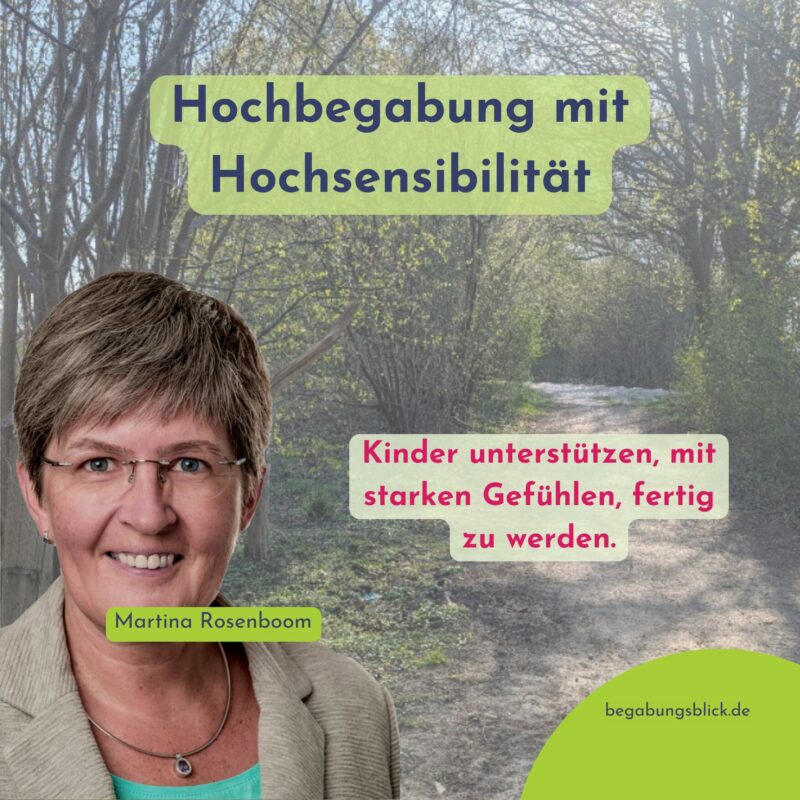
Ganz gleich, in welchem Bereich dein Kind hochsensibel ist: Es braucht dein Verständnis und deine Begleitung. Versucht, die Hochsensibilität nicht als Problem zu sehen, sondern als eine ganz besondere Begabung, die ein großes Geschenk sein kann.
Der Text ist im Original zu finden auf der Seite von Martina.
I CAN – ich kann das! Kinder unterstützen, mit starken Gefühlen fertig zu werden
Emotionale Intensität – das nennen viele Eltern, wenn wir sie im Elternkreis fragen, was ihnen bei der Hochbegabung ihres Kindes auffällt. Das Problem sind dabei weniger die Gefühle selbst als vielmehr die fehlende Regulation des emotionalen Zustands. Das lässt sich aber von den Kindern lernen und in einer fördernden Umgebung gut praktisch umsetzen.
Dabei werden vor allem negative Auffälligkeiten beschrieben: Schwierigkeiten, die eigenen Gefühle zu regulieren, Schwierigkeiten, mit starken Gefühlen anderer klarzukommen, der körperliche Ausdruck von Gefühlen und das hohe Maß an Selbstkritik. Dabei hat eine erhöhte Sensibilität auch positive Auswirkungen: Empathie und Mitgefühl für andere, die Fähigkeit für tiefe Freundschaften und eine große Breite an Gefühlswahrnehmungen.
Genau genommen sind die erhöhte Wahrnehmung und der erhöhte Ausdruck von Emotionen ein natürlicher Bestandteil einer Hochbegabung. Nach Dabrowski nehmen Hochbegabte mehr wahr und reagieren auch oft stärker als normal begabte Kinder. Im Big-5-Modell der Persönlichkeit (allgemein bekannter als Dabrowski) findet sich der Bezug im Anteil „Offenheit für Erfahrungen“: offen für Ideen (Intellekt), Fantasie, offen für Werte, für Gefühle und für anderes Verhalten.
Bei der (psychologischen) Diagnostik wird Hochsensitivität oft vernachlässigt. „Na ja, sie/er ist eben ein wenig überempfindlich …“ Dabei soll die Regulation von Gefühlen „von allein reifen“, „wenn sie älter werden“. Gerade hochbegabte Kinder erleben dabei eher und mehr Einflussfaktoren auf ihre Gefühlsregulation: Perfektionismus, unpassende Umgebung in der (Schul-)Klasse (z. B. Langeweile), allgemein Neurodiversität (mehrfach außergewöhnlich) und eine erhöhte Wahrnehmung der Welt mit Kriegen, Ungerechtigkeit etc. So sind gerade hochbegabte Kinder schneller als andere emotionell überfordert.
Das Problem sind dabei weniger die Gefühle selbst als vielmehr die fehlende Regulation des emotionalen Zustands. Das lässt sich aber von den Kindern lernen und in einer fördernden Umgebung gut praktisch umsetzen.
Emily Kircher-Morris hat dazu gute Maßnahmen in der I CAN-Methode zusammengeführt.
Investigate | Erforschen: erforsche deine Emotionen, sammle Fakten. Was sind Auslöser/Trigger, was ist der körperliche Ausdruck bei dir? Was ist bei Wechseln/Übergängen? Was sind Irritationen? Dabei geht es auch darum, in einer Detektiv-Perspektive ohne Wertung Informationen zu sammeln sowie zwischen Ursache und Ausdruck zu unterscheiden. In normalen Situationen lässt sich besser darüber sprechen, ein Journal/Tracker kann dabei unterstützen. |
Communicate | Mitteilen: Baue ein Vokabular auf (Hilfsmittel: z. B. Emotion-Wheel und Mood-Meter). Lerne, die Fehlregulation zu verbalisieren und Strategien zu erklären. Dies ist wichtiger Teil, die eigene Wirksamkeit und Handlungsmacht zu verbessern, z. B. Unterstützung zu suchen, um Hilfe zu bitten und Lösungen anzubieten. |
Activate | Aktivieren: Die Problemlösung muss aktiviert werden, das Wissen allein reicht nicht. Beim Priorisieren oder Überlegen einer Rangfolge hilft manchmal eine Umrechnung in Geld: Was wäre es dir wert, verglichen mit anderen Möglichkeiten? Der praktische Einsatz fördert die Reflexion und das Refraiming (Neubewertung und Neuausrichtung) |
Navigate | Steuern: Mit Methoden aus der Achtsamkeit und erhöhter Selbstwahrnehmung wird das Kind zum Kapitän auf dem eigenen Schiff: Atemzüge zählen oder lange Ausatmen sind kleine Werkzeuge, um der emotionalen Überforderung vorzubeugen. Dabei ist es oft auch hilfreich, dem Kind die wissenschaftlichen Erklärungen (altersgemäß) zu vermitteln. Dies ist auch für Menschen in der Umgebung wichtig, z. B. Lehrkräfte. |
Die Reihenfolge der vier Schritte ist dabei nicht festgelegt, sondern kann am individuellen Stand des Kindes angesetzt werden, z. B. wenn das Vokabular vorhanden ist, aber die selbst-gesteuerte Umsetzung bisher nicht klappt.
In manchen Fällen ist ein Mentor oder Begleiter hilfreich. Dies sollten nicht die Eltern sein: Zum einen sind sie oft „Teil des Problems“ durch ihre eigene hohe Sensibilität, zum anderen geht es darum, das Kind in seiner Unabhängigkeit zu fördern.
Aus den selbst entdeckten Auslösern und den entwickelten Maßnahmen lassen sich kleine Sticker o. Ä. erstellen, die dann z. B. am Kühlschrank oder Schreibtisch oder in der Federmappe schnell angesehen werden können.
I can – ich kann das!
Schon der Name motiviert und von den Kindern, die sich selbst regulieren können, sollten wir Erwachsenen uns gerne etwas abschauen!
Nach dem Vortrag „Helping Gifted and 2e Kids manage ‚All the Feels‘“ von Emily Kircher-Morris bei der SENG Mini-Conference am 10.12.2021 von Martina Rosenboom zusammengefasst.

Martina Rosenboom ist mit Talentconsalting eine kompetente Ansprechpartnerin und eine große Unterstützung für mich, um Eltern hochbegabter Kinder Texte wie diese zur Verfügung zu stellen. Herzlichen Dank an dieser Stelle.
Eltern hochbegabter Kinder finden Lösungen für das eigene Familienleben
Der Elternkreis Hochbegabung richtet sich ausschließlich an Familien mit begabten und hochbegabten Kindern. Diagnostik muss nicht vorliegen, denn in der Regel haben Eltern eine gute Einordnung.
Du bist hier nicht richtig, wenn:
🛑 die alleinige Schuld bei den Lehrkräften liegt
🛑 du dich einfach nur ausmotzen möchtest
🛑 du Lösungen serviert bekommen willst
Wenn du bis hier her gelesen hast, dann bist du offensichtlich an Lösungen interessiert und bereit, etwas dafür zu tun. Ein kleiner Blogartikel kann dir zwar einige neue Ideen liefern, aber ein Familienleben ändert sich dadurch nicht.
Kann eine individuelle Beratung hilfreich sein, oder ein Elternkreis Hochbegabung. In diesem Angebot sind zwei Expertinnen, die Ideen der Eltern notieren, selbst welche beisteuern und kleine Impulse geben. Hauptsächlich profitieren jedoch die Eltern von:
✅ Austausch untereinander
✅ verstanden werden
✅ Gemeinschaft spüren
In unseren Signalgruppen bleibt jede Gruppe für sich im Austausch. Tipps werden häufig noch weit nach dem Ende des Elternkreises geteilt. Eigentlich schaffen sich einige Eltern eine echte Mastermind.
Ein Elternkreis Hochbegabung dauert sechs Wochen und in dieser Zeit werden individuelle Ideen getestet. Die Eltern unterstützen einander mit ihren guten Erfahrungen und gleichzeitig arbeiten sie an ihren individuellen Themen.
So verändern sich die jeweiligen Familien langsam und genau im passenden Tempo. Es ist kein Angebot, das dir tausend Ideen liefert, von denen du keine umsetzen wirst. Eltern aus den Elternkreisen Hochbegabung wollen Veränderung und helfen einander. Wenn du das auch möchtest, dann melde dich an. Solltest du überzeugt sein, ein weiterer Blogartikel kann deine Probleme lösen oder ein weiteres Buch, dann lies gerne weiter. Veränderung beginnt im „Tun“, und das geht in der Gruppe mit viel Verständnis viel leichter. Wir sind immer zwei Expertinnen, die neue Ideen und Perspektiven zur Entwicklung beisteuern.
Melde dich jetzt an und werde Gestalterin deiner Familie, gemeinsam mit Expertinnen und anderen Eltern hochbegabter Kinder.